Interview
«Wir gehen auf der Geschichte von Leuten, die schon da waren»
Mit dem neuen Stück «MITOSIS – an LSD Opera» bringt Brandy Butler Tod, Angst und LSD auf die Bühne, als Oper. Ein Gespräch über all das.

Brandy Butler erarbeitet kreative Möglichkeiten an der Schnittstelle von Kunst und Gemeinschaft. Copyright: Brandy Butler
Aleksandra Hiltmann: Für alle, die noch nie von deinem neuen Stück gehört haben, um was gehts?
Brandy Butler: In «MITOSIS – an LSD Opera» geht es um eine Frau, die erfährt, dass sie schwer krank ist. Sie hat Angst, zu sterben, gleichzeitig versucht sie, die Situation zu akzeptieren. Um besser mit ihrer Angst klarzukommen, empfiehlt ihr eine Therapeutin, LSD auszuprobieren, durch eine sogenannte Psychedelika-assistierte Therapie. Das ganze Stück habe ich als Oper geschrieben.
Sterben, Angst, LSD, Oper – klingt etwas überwältigend.
Es ist mein Angebot an die Gesellschaft: Wir sollten mutiger werden, miteinander über den Tod zu sprechen.
Woher kommt dein Impuls dazu?
Für mich ist das Stück eine Art Gespräch, das ich nicht mehr mit meiner Mutter hatte führen können. Sie ist vor bald drei Jahren gestorben. Da habe ich festgestellt: Obwohl der Tod alle betrifft, sprechen viele nicht darüber. Ich möchte einen Austausch anregen und die Menschen mit dem Stück berühren. Meine Hoffnung ist, dass sich das Publikum mit der Protagonistin identifiziert und sich so Gedanken über den eigenen Tod machen kann. Das Stück ist nicht «ui krass!». Es gibt viel Raum für Verletzlichkeit.
Trotzdem: Der Tod ist kein leichtes Thema. Du hast deine Mutter verloren. Wie findet so eine persönliche Erfahrung den Weg auf eine öffentliche Bühne?
Alles fing damit an, dass ich in der «New York Times» einen Artikel über Psychedelika-assistierte Therapie gelesen habe. Damals war meine Mutter zwar bereits schwer krank, aber noch am Leben. Ich dachte: So eine Therapie wäre was für sie. Dann habe ich das Buch «On Death & Dying» von Elisabeth Kübler-Ross gelesen. Ich wollte wissen: Was erwartet mich, wenn ich jemanden in den Tod begleite? Als ich meine Mutter begleitet habe, bin ich mit ihr und gleichzeitig selbst auch auf eine Reise mit diesem Thema gegangen. Als Künstlerin fängt der künstlerische Impuls oft mit der eigenen Erfahrung an.
Handelt dieses Stück also von deiner Mutter?
Nein. Es ist nicht ihre Realität, es sind nicht ihre Worte. Die Figur ist fiktional. Irgendwie ist es aber doch ein Weg, den ich mir für sie gewünscht hätte.
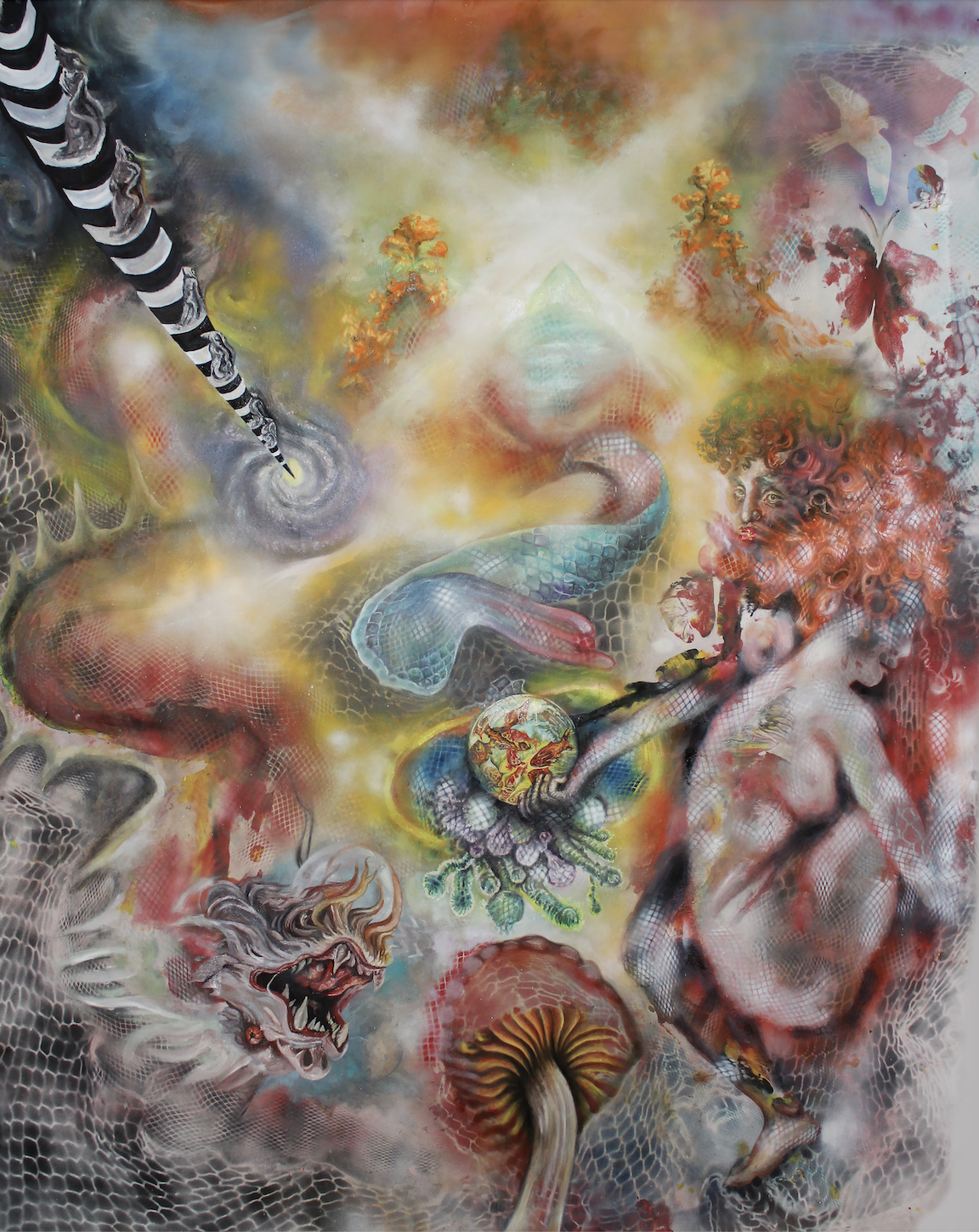
In «MITOSIS» geht es darum, den Tod zu akzeptieren. Aber da ist auch viel Angst und Wut. Wie hast du dich diesen Gefühlen angenähert?
In «On Death & Dying» beschreibt die Autorin die fünf Stufen der Trauer. Ich habe diese mit meiner Mutter erlebt. Die erste ist denial – du willst die Situation nicht wahrhaben. Meine Mutter scheint dort stecken geblieben zu sein. Erst im allerletzten Moment, als sie bereits nicht mehr sprechen konnte, hat sie kommuniziert, dass sie den Tod nun anerkennt. Die letzte der fünf Stufen. Und die Gefühle der anderen Stufen kennen wir wohl alle: Wut, Frustration, Depression. Ich zumindest habe viel Material in mir, mit dem ich arbeiten kann, auch wenn diese Erfahrungen nicht direkt mit dem Sterben zusammenhängen.
Der Tod erscheint mir oft abstrakt. Die einzelnen Gefühle, die ihn begleiten, sind uns aber vertraut?
Das hängt wohl davon ab, wie man auf das Leben blickt. Ich bin tausendmal gestorben und geboren worden. Zumindest ein Teil von mir, etwa wenn eine Freundschaft oder Beziehung zu Ende ging, wenn ich einen anderen Teil meines Lebens verändern musste oder wollte. Du vergisst diesen Teil nicht, aber du verabschiedest dich von ihm.
Wieso haben die Leute Angst vor dem Tod?
Es ist der Gedanke vom «ich» – was passiert, wenn ich sterbe? Wo gehe ich hin? Dabei geht es um ein stark egozentrisches Selbstbild: Ich will nicht vergessen werden. Ich aber glaube: Du wirst nie vergessen werden. Du gehst zurück zu einem grossen Ganzen. Dein Körper geht in irgendeiner Form zurück zur Erde und wird damit Neues nähren. Die Luft, die du einatmest, ist jene, die schon alle vor dir eingeatmet haben. Auch du wirst also immer in ihr da sein. Und ich glaube auch an den ersten Hauptsatz der Thermodynamik.
Und der besagt?
Energie kann nicht zerstört werden. Sie ändert lediglich ihre Form. Ich glaube, dass das auch mit uns so ist.
«Ich habe gemerkt, dass die Oper zwar auf institutioneller Ebene eingesehen hat, dass sie entspannter werden muss. Praktisch ist es aber doch so, dass die Vorstellungen, wie eine Oper auszusehen hat, dann doch sehr konkret sind.»
Hast du Angst vor dem Tod?
Natürlich. Ich möchte nicht sterben, jedenfalls nicht jetzt. Ich denke oft darüber nach, unter welchen Bedingungen ich dazu bereit wäre und was ich auf der Erde noch erledigen muss.
Hast du schon Antworten gefunden?
Nein. Ich bin eine krasse Over-Achiever*in. Will it ever be enough?
Viele haben also Angst vor dem Tod, auch du und deine Protagonistin. Die LSD-Therapie gegen diese Angst, die du im Stück einbringst, gibt es tatsächlich. Du und dein Team haben dazu recherchiert. Wie seid ihr vorgegangen?
Es gab verschiedene Phasen. In der ersten habe ich gelesen. Danach habe ich zusammen mit meinem Team mit Expert*innen aus der Praxis über Tod, Trauer und bewusstseinserweiternde Substanzen gesprochen. Unter ihnen war ein Palliativarzt aus der Region Zürich, der Schwerkranken Psychedelika-assistierte Therapien anbietet und auf diesem Gebiet forscht. Er hat uns erklärt, wie man Erfahrungen von Leuten auf LSD zu medizinisch-wissenschaftlichen Daten verarbeitet. Eine Psychiaterin hat uns erzählt, wie sie Personen auf Trips begleitet, eine Sterbebegleiterin, mit welchen Ritualen sie Menschen zur Seite steht. Letzteres war für mich sehr heilsam zu hören. Meine Mutter ist im Spital gestorben. Ich fand diese Atmosphäre grausam. Sie musste lange Schmerzen aushalten, bis sie gute Medikamente erhielt. Dann ist sie gestorben und wurde schnell aus dem Zimmer weggebracht, damit das Bett wieder frei wird. Es tat gut, zu hören, dass es auch anders geht.
Habt ihr während eurer Recherche auch bestimmte Orte besucht?
Wir waren unter anderem auf dem Friedhof Sihlfeld in Zürich. Die Energie in den Gebäuden war für mich teils schwer auszuhalten. Einen Kindersarg zu sehen, ist nicht leicht. Aber es gab auch schöne Einblicke.
Zum Beispiel?
In der Schweiz beträgt die obligatorische Ruhefrist 20 Jahre, das heisst: Regulär wird man auf dem Friedhof für mindestens 20 Jahre begraben. Hat man kein Miet- oder Privatgrab, wird das Grab danach oberirdisch geräumt. Möchten die Angehörigen den Grabstein nicht abholen, wird er etwa in Zürich wiederverwertet – und kann so zu Strassenbelag werden.
Wie bitte?
Ja. Ich fand diesen Gedanken schön. So gehen wir auf der Geschichte von Leuten, die schon da waren.

Zurück zu den Projektphasen. Was kam nach der Recherche?
Die Musik. Und danach haben wir uns damit befasst, wie man psychedelische Erfahrungen für die Bühne gestalten kann. Oft sieht das klischiert aus: Jemand läuft mit der Hand vor dem Gesicht rum. Wir wollten andere Bilder finden. Danach feilten wir nochmals an der Musik.
Das Stück ist eine Oper. Wie kam es dazu?
Vor fünf Jahren habe ich zusammen mit einer Freundin LSD genommen. Auf dem Trip sagte ich aus Witz: Ich schreibe eine LSD-Oper. Ein paar Monate später wurde ich für eine Residency des Europäischen Netzwerks der Opernakademien (ENOA) akzeptiert, ein Zusammenschluss der grössten Opernhäuser Europas. Ziel war es, dass sich Leute mit Oper befassen, die out of the box denken. In meiner Gruppe waren queere Menschen, Leute mit Fluchthintergrund, Leute, die rassifiziert werden. Man sagte uns, dass wir für eine Oper locker viel Geld kriegen würden. Das hat mich ermutigt – auch wenn es am Ende anders kam.
Warum?
Ich habe gemerkt, dass die Oper zwar auf institutioneller Ebene eingesehen hat, dass sie entspannter werden muss. Praktisch ist es aber doch so, dass die Vorstellungen, wie eine Oper auszusehen hat, dann doch sehr konkret sind. Tut sie das nicht, gibts kein Geld.
Du hast trotzdem deine eigene Oper geschrieben.
Yes! Es hat Jahre gedauert und bedurfte der Hilfe vieler Co-Kollaborateur*innen. Aber nun ist es geschafft!
Ich habe auf Youtube in einen Ausschnitt reingehört. Ich dachte, die Musik würde düster klingen. Aber da sind viele witzige Passagen. Wie hast du die Balance zwischen ernst und lustig gefunden?
Am Ende der dritten Phase haben wir die Rohfassung des Stücks verschiedenen Leuten gezeigt. Unter ihnen war ein Wissenschaftler, der das Vokabular psychedelischer Erfahrungen erforscht. Er meinte: Vergesst nicht, dass Trips auch sehr lustig sind. Das haben wir uns zu Herzen genommen. Und auch der Tod ist ja nicht nur düster.
Nicht?
Nein. Es gibt zwar die Diagnose, aber danach auch das Leben. Es kann sein, dass du trotz einer unheilbaren Krankheit noch lange lebst.
Was hat dich an dieser Recherche am meisten überrascht?
Wie eine Psychedelika-assistierte Therapie funktioniert. Ich dachte, dass man während des Trips eng begleitet würde, dass jemand ständig fragen würde, wie es dir gerade geht. Ein international anerkannter Schweizer Experte auf diesem Gebiet, Peter Gasser, erklärte mir, dass jede Person – hoch dosiert – auf ihre eigene Reise gehe. Erst wenn man wieder vom Trip zurück ist, beginnt die Arbeit. Erst dann setzt man sich damit auseinander, was man gesehen hat und warum es einem schwerfällt, loszulassen im Leben. Das sei wie eine Übung zum Sterben, meinte ein Palliativarzt zu dieser Form der Therapie.
«Wir sterben. The end. Aber wir verkomplizieren es gerne.»
Deine Protagonistin absolviert so eine Therapie. Ist dein Stück eine Art Kollektivtherapie für uns und unsere Angst vor dem Tod?
Ich wollte die Hauptfigur gezielt so gestalten, dass sich das Publikum mit ihr identifizieren kann und so auch mit eigenen Erfahrungen. Vielleicht schaut eine Person zu, die selbst bereits jemanden beim Sterben begleitet hat und dies nun über meine Figur aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und ja, ich erhoffe mir, dass die Leute nach der Vorstellung das Gefühl haben: Ich habe geübt, zu sterben. In diesem Sinne ist es eine Kollektivtherapie.
Wie hat dich die Arbeit an diesem Stück verändert?
Ich bin nun 45 Jahre alt und habe das Gefühl: I grew up. Der Tod meiner Mutter hat viel verändert, gerade die Beziehung zu mir selbst. Wer bin ich ohne die Person, die mein Leben abgesehen von mir am meisten geprägt hat? Ich bin nun eher dazu bereit, zu akzeptieren, dass ich sterben werde. Ich musste dafür viel mit mir diskutieren oder streiten. Aber am Ende kann es doch so einfach sein: Wir sterben. The end. Aber wir verkomplizieren es gerne.
Wie blickst du nun anders auf den Tod?
Früher dachte ich, dass Sterben etwas sei, das wir tun, und der Tod uns passiere. Aber: We live through death. It’s an experience. Der Tod passiert uns nicht, er ist eine Reise an einen anderen Ort, auch wenn dieser Ort ein Nirgendwo, nothingness, ist.
Was hast du bei der Recherche zum Tod über das Leben gelernt?
Dass ich schon jetzt mit dem Tod durchs Leben gehe. Der Tod ist mein Begleiter. Wenn ich nun einer Person sage, dass ich sie liebe, kommt das von einem ganz anderen Ort, gerade weil ich die Endlichkeit des Lebens die ganze Zeit spüre. Macht das Sinn?
Ja …
Ein Beispiel: Kurz bevor meine Mutter gestorben ist, haben wir am Telefon gestritten, über Geld. Es war unser letztes Gespräch. Damals hatte ich das Gefühl, fest im Leben zu stehen. Ich dachte, dass wir Zeit hätten, uns zu versöhnen. Kurz danach ist sie gestorben. Diese Erfahrung hat mich verändert, zu wissen: Du weisst einfach nie, ob morgen jemand stirbt. Nun, da ich mit dieser Erkenntnis durchs Leben gehe, fühlen sich Interaktionen anders an … wahrer … verbundener.
Klingt wie bei Leuten, die nur knapp dem Tod entkommen sind und danach bewusster durchs Leben gehen.
Das ist mir tatsächlich passiert. Ich hatte einen Autounfall und bin fast gestorben. In der Zeit danach fühlte ich mich unglaublich lebendig. Alles schien brandneu, das Essen schmeckte so gut wie noch nie, ich schätzte die Möglichkeit, leben zu können. Irgendwann habe ich dieses Gefühl verloren und alles war wie vorher. Aber ich werde mich nie an den Gedanken gewöhnen, dass Leute einfach so sterben können. Vor dieser Tatsache muss und werde ich immer Respekt haben.
Brandy Butler ist zeitgenössische Performancekünstler*in, Musiker*in, Musikpädagog*in und Aktivist*in. Brandy Butler wurde in den USA geboren und studierte im Bachelor Jazz an der University of Arts in Philadelphia. 2003 kam Brandy Butler als Aupair in die Schweiz und studierte im Master Gesangspädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste.
2012 sang sich Brandy Butler ins Finale von «The Voice of Switzerland». Brandy Butler arbeitete mit Musiker*innen wie Stress, Erika Stucky, Sina, Steff la Cheffe und Sophie Hunger und tourte international mit eigenen Bands.
Die Künstler*in war im Ensemble vom Theater Neumarkt und engagiert sich in Foren und Organisationen für gesellschaftliche Diversität und Gleichberechtigung.
«MITOSIS – an LSD Opera»
Brandy Butler
Do, 3.4.2025, 20 Uhr
Sa, 5.4.2025, 20 Uhr
Di, 8.4.2025, 20 Uhr
Do, 10.4.2025, 20 Uhr
AUSVERKAUFT
Mehr Beiträge
Fünf Akte des Kollapses
11. Februar 2026
Von Team Gessnerallee
Drei Fragen an Simone Aughterlony zu ihrem neuen Stück «Collapse in 5 Acts: There Is Porn of It». Wochenbrief #68 Lesen


Fünf Akte des Kollapses
11. Februar 2026
Von Team Gessnerallee
Drei Fragen an Simone Aughterlony zu ihrem neuen Stück «Collapse in 5 Acts: There Is Porn of It». Wochenbrief #68 Lesen

Das Programm im Februar
4. Februar 2026
Von Team Gessnerallee
Vier Premieren, zwei Gesprächsreihen, eine Rechtsberatung und ein Workshop. Wochenbrief #67 Lesen

Ein Grund, zu feiern
28. Januar 2026
Von Team Gessnerallee
Relaxed Parties und Disabled Leadership. Wie und durch wen können Veranstaltungen barrierefrei gestaltet werden? Wochenbrief #66 Lesen